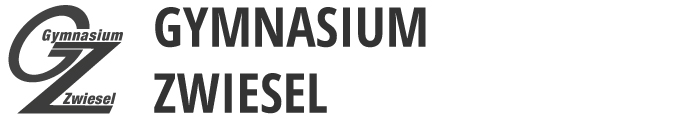47. Edgar-Lüscher-Seminar beleuchtet „Neues aus der Astrophysik“
Das Weltall, unendliche Weiten. Diese Einleitung aus der Serie „Raumschiff Enterprise“ wäre wohl auch ein guter Einstieg in das diesjährige Edgar-Lüscher-Seminar am Gymnasium Zwiesel gewesen. Zum 47. Mal fand die vom Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Niederbayern in Kooperation mit der TU München veranstaltete Fortbildung für Physiklehrer statt. Ein ganzes Wochenende, von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag, beschäftigten sich die Lehrerinnen und Lehrer und auch andere Interessierte in acht Fachvorträgen mit den neuesten Erkenntnissen und Theorien aus der modernen Astrophysik. Obwohl jeder der Vorträge auf gesicherten Erkenntnissen und Arbeitsweisen der vortragenden Wissenschaftler basierte, hätte man bisweilen glauben können, man erhält Berichte aus einem abgefahrenen Science-Fiction-Roman.
Die Colaflasche als wissenschaftlicher Assistent
Auftakt zum Seminar war ein Schülervortrag am Freitagvormittag, an dem über 200 Schülerinnen und Schüler verschiedener Gymnasien teilnahmen. Dr. Andreas Kratzer (TUM School of Education) und Dr. Silke Stähler-Schöpf (Max-Planck-Institut für Quantenoptik) gaben, unterstützt von Dr. Alice Smith-Gicklhorn und Dr. Stefan Waldenmaier vom Exzellenzcluster ORIGINS, eine Einführung in die Arbeitsweisen und Erkenntnisse der modernen Astronomie. In Versuchen demonstrierten sie unter anderem, wie Parabolantennen Wärmestrahlung aus dem Universum fokussieren können und so als Teleskope in diesem Wellenlängenbereich eingesetzt werden. Anhand einer vollen Colaflasche wurde der Nutzen dieser Technologie gezeigt. Während die Flasche im Wellenlängenbereich des sichtbaren Lichts undurchsichtig ist, konnte man im Infraroten durch die Flasche hindurchsehen. Ein Prinzip, das genauso in der Astronomie eingesetzt wird, um durch störende Objekte hindurchsehen zu können.
Von der Expansion des Universums
Am Freitagnachmittag starteten dann die Fachvorträge. Prof. Winfried Petry und Prof. Müller-Buschbaum von der TU München ist es gelungen, ein spannendes und abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Sprechern aus der Spitzenforschung zusammenzustellen. Unterstützt wurden sie bei der Suche nach geeigneten Sprechern vom Exzellenzcluster ORIGINS, einem interdisziplinären Forschungsverbund verschiedener Universitäten und Institute, der sich der Erforschung der Entstehung des Universums vom Urknall bis zur Entstehung des Lebens widmet.
Der Reigen der Vorträge wurde von Dr. Maximilian Fabricius vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik eröffnet. Er erläuterte, wie das Weltraumteleskop Euclid zur genauen Vermessung der Expansion des Universums eingesetzt wird und welche Erkenntnisse bereits gewonnen werden konnten. Zunächst überließ er dabei die Analyse einer Aufnahme des Weltraumteleskops dem Publikum. Dabei stieß man schnell auf eine Gravitationslinse im Bild. Von deren Beobachtung, so Dr. Fabricius, erhofft man sich Aufschluss über die Verteilung dunkler Materie im Weltall.
Von der Teleskopbrille ALMA
Den ersten Seminartag beschloss Prof. Til Birnstiel von der LMU. Er widmete sich in seinem Vortrag der Frage, wo der Boden unter unseren Füßen herkommt, und klärte darüber auf, was man heute über die Entstehung von Planeten weiß. Er erläuterte, dass Planeten in Scheiben aus Staub und Gas um junge Sterne gebildet werden. Dazu gibt es verschiedene Theorien, die aber bisher durch fehlende Beobachtungsmethoden nicht überprüft und ausgebaut werden konnten. Allerdings setzte das Teleskop ALMA, das aus 66 Parabolantennen besteht, die im Abstand von bis zu 16 km verteilt sind, den Astronomen sozusagen die Brille auf. Die Anlage in den Anden erlaubt bisher unerreichte Auflösungen in diesem Bereich, sodass in den weit entfernten Staub- und Gasscheiben plötzlich Strukturen erkannt werden können, die bei der Klärung der Frage nach der Planetenentstehung Antworten liefern.
Mit dem Aufzug durch das Schwarze Loch
Am Samstagvormittag eröffnete Prof. Julian Adamek von der Universität Zürich den zweiten Seminartag. Er berichtete den Zuhörern von Schwarzen Löchern – extremen Masseansammlungen auf kleinstem Raum. Die Gravitationseffekte in ihrer Nähe sind so stark, dass sie beim Unterschreiten eines bestimmten Abstands nicht einmal mehr von Licht verlassen werden können. Prof. Adamek schickte in einem Gedankenexperiment die Seminarteilnehmer in einem Aufzug in ein solches Schwarzes Loch und erläuterte die verblüffende Tatsache, dass man beim Beobachten eines Schwarzen Lochs von vorne auch die Rückseite sieht, als könnte man von seinem Gegenüber beim Blick ins Gesicht auch den Hinterkopf betrachten.
Blick in die Weiten des Universums
Anschließend referierte Dr. Rhea-Silvia Remus von der LMU über das James-Webb-Weltraumteleskop, das die Erde im sogenannten Lagrangepunkt L2 seit 2022 begleitet und von dort aus das Universum im infraroten Bereich beobachtet. In diesem Wellenlängenbereich ist es möglich, sehr weit nach draußen zu blicken. Das bedeutet aber auch, dass man sehr weit in die Vergangenheit des Universums blicken kann. Dr. Remus erklärte, wie dadurch die Möglichkeit eröffnet wurde, 13,5 Milliarden Jahre in der Entwicklung des Weltalls zurückzublicken und die sehr frühen Strukturbildungsprozesse im Universum direkt zu beobachten. Dadurch erklärte sie, dass nun Simulationen, die auf theoretischen Überlegungen beruhen, überprüft und damit die Theorien belegt oder verworfen werden können.
Geheimnisvolle dunkle Materie
Dr. Steffen Hagstotz von der LMU berichtete am Nachmittag von dunkler Materie. Er erklärte, dass diese Materieform nicht direkt beobachtbar ist, jedoch durch gravitative Wechselwirkungen auf sie geschlossen werden kann. Modelle legen nahe, dass die uns bekannte Materie nur etwa 5 % der Energiedichte im Universum ausmacht, während die dunkle Materie 27 % ausmacht. Trotzdem ist noch immer nicht bekannt, worum es sich dabei genau handelt. Die Bahn von Sternen am Rand einer Galaxie legt jedoch nahe, dass Galaxien in einen riesigen Halo aus dunkler Materie eingebettet sind. Die Seminarteilnehmer erfuhren, dass alle bisher bekannten Elementarteilchen als Kandidaten für dunkle Materie ausgeschlossen sind und welche anderen Kandidaten beispielsweise in Frage kommen könnten.
Vom Klang des Universums
Mit Dr. Frank Ohme vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover durften die Lehrer dem Klang des Universums lauschen. Er brachte seinen Zuhörern Gravitationswellen näher. Dabei handelt es sich um Wellen in der Raumzeit, die z. B. entstehen, wenn sich schwarze Löcher gegenseitig umkreisen. Dabei wird der Raum selbst gestreckt und gestaucht. Diese Störung breitet sich in der Raumzeit aus und führt zu minimalsten, aber für die Wissenschaftler messbaren Längenänderungen. Sie messen dabei in Interferometern Längenänderungen im Bereich eines Bruchteils eines Protonendurchmessers. Gravitationswellen lassen sich in akustische Signale umwandeln. So machte es Dr. Ohme den Anwesenden möglich, zwei schwarze Löcher zu belauschen, die sich zunächst immer schneller umkreisten und anschließend verschmolzen.
Blick durch die kosmische Lupe
Auch am Sonntagvormittag standen noch spannende Vorträge auf dem Seminarprogramm. Jana Grupa vom Max-Planck-Institut für Astrophysik wagte den Blick durch die kosmische Lupe. Sie zeigte, wie Gravitationslinsen bei der Enthüllung des Universums helfen. Sie erklärte, dass Gravitationslinsen wie natürliche kosmische Teleskope wirken, indem sie das Licht von entfernten Objekten durch die Gravitation eines massiven Vordergrundobjekts, wie einer Galaxie oder eines Galaxienhaufens, verstärken und verzerren. Diese Methode ermöglicht es, sehr schwache und weit entfernte Objekte wie frühe Galaxien oder Quasare zu beobachten. Außerdem ist durch Gravitationslinseneffekte die indirekte Beobachtung dunkler Materie möglich, wie Grupa erläuterte.
Von Neutrinos zum Kollaps des Universums
Den Schlussakkord setzte Prof. Lothar Oberauer von der TUM. Er ging in seinem Vortrag darauf ein, was Neutrinos über Sternkollaps, Supernovae und Nukleosynthese – die Fusion von leichten Elementen zu schweren in Sternen – verraten können. Bei all diesen Prozessen, so Prof. Oberauer, wird eine Vielzahl an Neutrinos in das Weltall gestrahlt. Beim Sternkollaps werden sogar 99 % der Energie in Form von Neutrinos abgestrahlt. Sie bieten so eine gute Informationsquelle, um diese Prozesse besser zu verstehen. Ein einziges Problem: Neutrinos sind äußerst wechselwirkungsunwillige Elementarteilchen. Oberauer zeigte an aktuellen Beispielen, welcher Aufwand deshalb betrieben werden muss, um sie zu beobachten. Als Beispiel führte er den Detektor SuperKamiokande in Japan an, einen Tank, gefüllt mit 50.000 Tonnen Reinstwasser, der mit 12.000 Photomultipliern ausgestattet ist. Über die Wechselwirkung zwischen Neutrinos und Wasser können die Teilchen damit detektiert werden.
Freude über Spitzenwissenschaft
Nach dem Schlussvortrag dankten die wissenschaftlichen Leiter des Seminars, Prof. Müller-Buschbaum und Prof. Petry, allen Sprechern für die mitreißenden und spannenden Vorträge. StR Stephan Loibl bedankte sich stellvertretend für das Gymnasium Zwiesel bei den beiden Professoren für die Zusammenstellung des abwechslungsreichen Programms. Besonders hob er dabei hervor, dass die beiden jedes Jahr aufs Neue Spitzenwissenschaftler nach Zwiesel bringen, die mit Freude und Begeisterung den anwesenden Lehrern Rede und Antwort zum Status quo der Wissenschaft stehen. „Nun liegt es an uns, diese Begeisterung in die Klassenzimmer zu tragen“, so Loibl. Als Dank überreichte er allen Referenten und den beiden wissenschaftlichen Leitern Glaspräsente, die von Zwiesel Glas zur Verfügung gestellt wurden.
Abschließend legte man Thema und Termin des 48. Edgar-Lüscher-Seminars fest: Von 17. bis 19. April 2026 wird man sich am Gymnasium dem Thema „Plasmaphysik und Fusion“ widmen.
(Stephan Loibl)